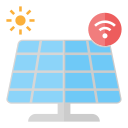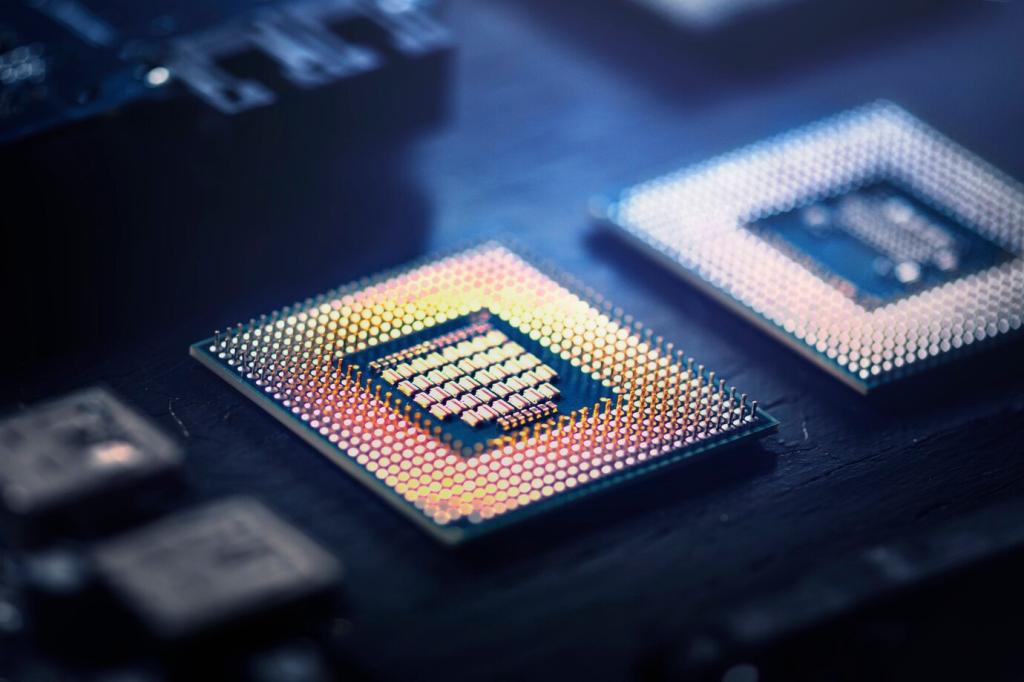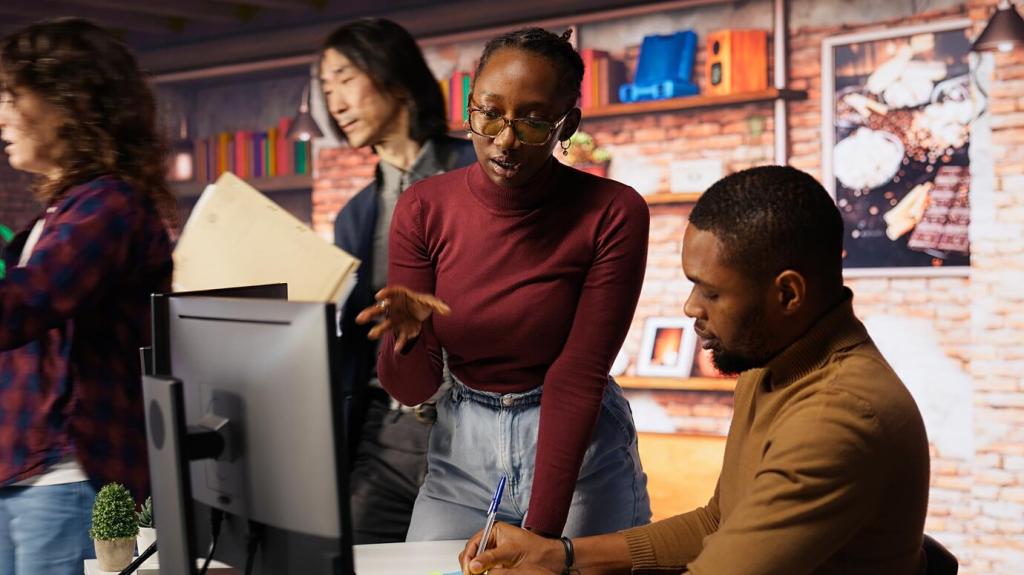Fallstudie (fiktiv): Ein Stadtwerk gewinnt Klarheit
Das Stadtwerk Sonnenheim kämpfte mit volatileren Profilen durch schnell wachsende Dach-PV. Ausgleichsenergiekosten stiegen, Disponenten arbeiteten im Dauerstress. Die bestehende Physik-only-Prognose unterschätzte Wolkenfronten. Kennen Sie diese Situation? Erzählen Sie, wo bei Ihnen der Schuh drückt.
Fallstudie (fiktiv): Ein Stadtwerk gewinnt Klarheit
Ein hybrides Modell kombinierte Ensemble-Wetter, Satelliten-Nowcasts und Telemetrie. Quantilprognosen lieferten Unsicherheitsbänder, eine Kalibrierung passte Bias je Wetterlage an. MLOps automatisierte Retraining und Monitoring. Möchten Sie den Modellablauf im Detail? Abonnieren Sie und erhalten Sie die Prozessgrafik.